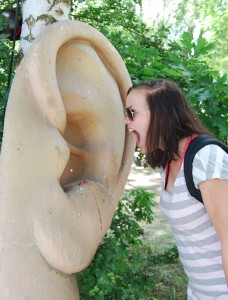Leider sind die Literaturangaben nicht einheitlich, weil ich sie verschiedenen Seminaren entnommen habe.
Einige von den aufgeführten Texten bieten leider keine ausführliche Literaturangabe.  Aber ich finde es trotzdem gut hier einen Ideenanstoß, wo man mal „reinlesen“ könnte, zu bieten.
Aber ich finde es trotzdem gut hier einen Ideenanstoß, wo man mal „reinlesen“ könnte, zu bieten.
Sowohl für mich (um endlich einmal alles beisammen zu haben) als natürlich auch für diejenigen, die im Studium nach Literatur suchen..
Guter Unterricht:
– Lehrer sein heißt, Kindern Flügel verleihen (DIHK)
Störungen:
– Nolting, Hans-Peter (2007): Störungen in der Schulklasse
– Keller, Gustav (2010): Vulkangebiet Schule: Konfliktdiagnose, Konfliktlösung, Konfliktprävention
– Keller, Gustav (2008): Ich will nicht lernen!: Motivationsförderung in Elternhaus und Schule
– Keller, Gustav (2008): Disziplinmanagement in der Schulklasse: Unterrichtsstörungen vorbeugen-Unterrichtsstörungen bewältigen
Heterogenität:
– Norbert Wenning: Heterogenität als Dilemma für Bildungseinrichtungen. In: Sebastian Boller/ Elke Rosowski/ Thea Stroot (Hg.): Heterogenität in Schule und Unterricht. Weinheim, S. 21-31
Binnendifferenzierung:
– Heymann, Hans Werner: Binnendifferenzierung – eine Utopie? Pädagogik 11/ 10: 6-11
– Wischer, Beate; Trautmann, Matthias: Ich tue es nicht, also bin ich ein schlechter Lehrer? Pdagogok 11/ 10: 32-34
– Lau, Ramona: Innere Konsequenz konsequent anwenden. Pädagogik 11/ 10: 28-31
– Wolff, Martina: Individualisierung und Differenzierung (www.praxis-fremdsprachenunterricht.de/ 3-2009): 3-7
– Steveker, Martin: Individualisierung im Spanischunterricht. Der fremdsprachliche Unterricht Spanisch. Heft 28/ 2010: 4-9
– Hass, Frank: Keiner wie der andere. Der fremdsprachliche Unterricht Englisch. Heft 94/ 2008: 2-9
– Kuty, Margitta: Binnendifferenzierung in Aktion (www.praxis-fremdsprachenunterricht.de/ 3-2009): 16-18
Wortschatzarbeit:
– Adamczak-Krysztofowicz, S., Stork, A. (2007). Zum Vokabellernen befähigen: Lernstrategien vermitteln. In: PRAXIS Fremdsprachenunterricht, Heft 6, S. 27-31.
– Aitchinson, J. (1997). Wörter im Kopf: Eine Einführung in das mentale Lexikon. Tübingen: Niemeyer.
– Bergmann, B. (1998). Wortschatzarbeit (1) + (2). Lernstrategien und Übungsformen zur Erhöhung der Lernerautonomie. In: Zielsprache Englisch, S. 94-109.
– Börner, W. (2000). Didaktik und Methodik der Wortschatzarbeit: Bestandaufnahme und Perspektiven. In: Germanistische Linguistik, S. 29-56.
– Decke-Cornil, H.; Küster, L. (2010). Fremdsprachendidaktik. Tübingen: Narr, S. 163-173.
– De Florio-Hansen, I. (2001). Fremdsprachenlernende zu Wort kommen lassen oder: Vom Umgang mit dem Wortschatz. In: Jung, U. (Hrsg.), Praktische Handreichung für Fremdsprachenlehrer. Frankfurt: Lang, S.302-309.
– Del Valle Luque, V. (2009). Poesía Visual für kreatives Wortschatzüben. In: Der fremdsprachliche Unterricht Spanisch, Heft 27, S. 22-31.
– Grünewald, A. (2007). Wortschatzbildung im Fremdsprachenunterricht. In: Hispanorama 116, S. 63-70.
– Grünewald, A.; Küster, L. (Hrsg.) (2009). Fachdidaktik Spanisch. Tradition, Innovation, Praxis. Stuttgart: Klett, S. 202-206.
– Grünewald, A.; Roviró, B. (2009). Alternative Formen der Wortschatzüberprüfung. In: Der fremdsprachliche Unterricht Spanisch, Heft 27, S. 28-35.
– Hauf de Quintero, I. (2009). Interaktive Wortschatzarbeit mit der Lernplattform moodle. In: Der fremdsprachliche Unterricht Spanisch, Heft 27, S. 38-41.
– Leupold, E. (2002). Französisch unterrichten. Grundlagen, Methoden, Anregungen. Kempten: Kallmeyer, S. 248-271.
– Meier, D. (2009). Trabajar con un diccionario monololingüe. Methodenkompetenz zur Nutzung einsprachiger Wörterbücher schulen. In: Der fremdsprachliche Unterricht Spanisch, Heft 27, S. 42-48.
– Meißner, F-J. (1999). Transfer beim Erwerb einer weiteren romanischen Fremdsprache: Das mehrsprachige mentale Lexikon. In: Meißner, F-J.; Reinfried, M. (Hrsg.), Mehrsprachigkeitsdidaktik. Konzepte und Erfahrungen mit der romanischen Mehrsprachigkeit im Unterricht. Tübingen: Narr, S. 45-68.
– Meißner, F-J. (1999). Das mentale Lexikon aus der Sicht der Mehrsprachigkeitsdidaktik. In: Grenzgänge 6, Heft 12, S. 62-80.
– Neveling, C. (2004). Wörterlernen mir Wörternetzen: Eine Untersuchung zu Wörternetzen als Lernstrategie und als Forschungsverfahren. Tübingen: Narr.
– Neveling, C. (2007). Lernstrategie: Wörternetze. In: Der fremdsprachliche Unterricht Französisch, Heft 90, S. 2-8.
– Nieweler, A. (Hrsg.) (2006). Fachdidaktik Französisch. Tradition, Innovation, Praxis. Stuttgart: Klett, S. 174-189.
– Pesce, S. (2002). Speicherung und Vernetzung der Präpositionen im mentalen Lexikon der Lerner und Muttersprachler des Spanischen und des Deutschen. Univ. Hamburg (unveröffentlichte Magisterarbeit).
– Röhr, G. (2000). Bedeutungserschliessung aus dem Kontext. Eine Strategie für den Lerner. In: Kühn, P. (Hrsg.), Wortschatzarbeit in der Diskussion. Hildesheim: Olms, S. 209-223.
– Sánchez Serdá, M. (2009). TEO, un nuevo amigo en la clase de español. In: Der fremdsprachliche Unterricht Spanisch, Heft 27, S. 16-21.
– Stork, A. (2010). Wortschatzerwerb. In Hallet, W.; Königs, F.G. (Hrsg.), Handbuch Fremdsprachendidaktik. Stuttgart: Klett, S. 104-106.
Einsprachigkeit:
– Butzkamm, Wolfgang: Schwache Englischleistungen – woran liegt’s? Glanz und Elend der Schule oder die Wirklichkeit des Fremdsprachenschüler. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht 12: 1, 2007, 17 S.
– Butzkamm, Wolfgang; Schmid-Schönbein, Gisela: Funktionale Fremdsprachigkeit. Zur Rolle der Sprachen im Englischunterricht. In: Grundschulmagazin Englisch / The Primary English Magazine 5/2008, 6-8
Kompetenzorientierung:
– Bildungsstandards 2010. KMK.
– Harsch, Claudia; Nöth, Dorothea: Was können die fremdsprachlichen Bildungsstandards leisten? In: Praxis Fremdsprachenunterricht 6-2007: 2-6
– Weskamp, Ralf: Kommunikative Kompetenz als Ziel des Fremdsprachenunterrichts in der Grundschule. In: Grundschulmagazin 2 (2004). Nr. 6: 7-10
– Nieweler, Andreas: Zur Förderung mündlicher Kompetenzen im Französischunterricht. In: Fremdsprachlicher Unterricht – Französisch (Heft 55, 2002, 4-12)
Interkulturelle Kompetenz:
– Harald Grosch/Wolf Rainer Leenen: Bausteine zur Grundlegung interkulturellen Lernens. In: Bundeszentrale für politische Bildung: Interkulturelles Lernen. Arbeitshilfen für die politische Bildung. Bonn 1998, S. 29-46
– Paul Mecheril: „Kompetenzlosigkeitskompetenz“. Pädagogisches Handeln unter Einwanderungsbedingungen. In: Georg Auernheimer (Hg.): Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität. 3. Aufl. Wiesbaden 2010, S. 15-34
– Georg Auernheimer: Interkulturelle Kommunikation, mehrdimensional betrachtet, mit Konsequenzen für das Verständnis interkultureller Kompetenz. In: a.a.O., S. 35-65